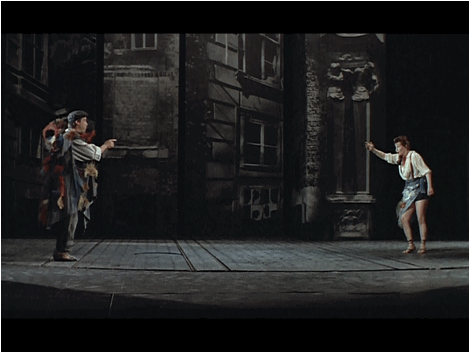“Pass gut auf Mutti auf!”
Auf dem langen Flur klingelte es schrill. Endlich war Mathe vorbei. Peter, Kalle und Atze rutschten schon unruhig auf ihrer Bank hin und her. Auch die anderen wurden unruhig. Doch Frau Herrlich ließ sich Zeit. “Wann kriegt die endlich ihren dicken Arsch vom Lehrerstuhl hoch?”, flüsterte mir Gerd zu. “Die Pause hatte doch schon begonnen.” Endlich stand sie, sich mühsam auf dem Tisch abstützend, auf, verstaute das Klassenbuch in ihrer großen Handtasche und watschelte zur Tür. Als sie nicht mehr in Sicht war, rief Janno: “He, Atze, mach mal die Klassentür zu, aber von außen, und sag Bescheid, wenn Kühn kommt.”
Herr Kühn war unser Klassenlehrer und unterrichtete Deutsch und Geographie. Meist kam er ein, zwei Minuten zu spät zum Unterricht, z. B. morgens in der ersten Stunde oder wenn er noch schnell ein paar Landkarten in unser Klassenzimmer bringen wollte und nicht mehr die Zeit gehabt hatte, ein oder zwei von den Jungs zu bitten, ihm zu helfen. Dabei hätte er es eigentlich auch allein schaffen können, denn es war gar nicht weit von seinem “Kartenzimmer”, wie er es nannte, zu uns.
Sein Kartenzimmer, wohin er sich in den Pausen flüchtete, wenn er keinen Ordnungsdienst auf dem Flur oder Hof hatte, sah eigentlich eher wie eine Rumpelkammer aus. Auf dem Tisch stand ein großes rundes Tintenfass, neben dem ein paar von diesen altmodischen Federhaltern und ein paar angespitzte Bleistifte lagen. In der rechten Ecke der dunklen Schreibtischplatte, in der die Schülerweisheiten verschiedener Generationen eingeschnitzt waren, lag eine offene Brotbüchse aus Aluminium, in der sich fast immer eine große Leberwurststulle und ein paar geschälte Apfelstückchen befanden. Neben dem Fenster hatte er seinen Garderobenständer postiert, an den er, auch wenn es schon seit Wochen nicht mehr geregnet hatte, gewöhnlich seinen hellen Trenchcoat, seine dunkelblaue Baskenmütze und seinen hellbraunen Seidenschal hängte. Auf dem Fensterbrett stand ein Kaktus und manchmal sogar eine Blumenvase mit irgendwelchem Grünzeug.
An der Wand dem Fenster gegenüber stand Max, das Skelett, dem Herr Kühn einen grünen Schal umgebunden hatte. Wahrscheinlich hatte den mal einer seiner Schüler vergessen. Außerdem hatte er Max eine Pfeife zwischen die Zähne geschoben. Die musste noch von seinem Vorgänger stammen, denn Herr Kühn war Nichtraucher. Ich habe mich oft gefragt, ob er das lustig fand. Ich meine Max mit der Pfeife zwischen den Zähnen; ich jedenfalls nicht. Vielleicht hatte er das gemerkt und lud mich deshalb nicht so oft in seine Rumpelkammer ein. Vielleicht gehörte ich auch nicht zu seinen Lieblingsschülern.
Wenn kein Lehrer in der 8c war, hatte Janno das Sagen. Er trainierte schon seit einem halben Jahr Boxen bei FC Dynamo, dem Polizeiverein, erzählte er uns jedenfalls ganz stolz. Fast noch beeindruckender war seine Ente, die er mit Wasser und ein bisschen “Glätt” bis Mittag in Form hielt. Heidi und Monika fanden sogar, dass er mit diesem Haarschnitt, wenigstens von hinten, aussah wie Elvis. Das hatte ich von Brigitte, meiner Banknachbarin, die mit der großen Brille und dem langen Pferdeschwanz.
Gerd, Bernd und manchmal auch Janno gingen öfter in Kühns Kartenzimmer. Ich glaube, sie empfanden es als eine Art Auszeichnung, wenn er sie “hinbeorderte”, mal wieder die aufgerollten Karten zu sortieren. Übrigens keine schwere Aufgabe, denn die erwünschte Reihenfolge war allen bekannt, die Kühn im Laufe des Schuljahrs in sein Kartenzimmer beordert hatte, auch mir. Ganz rechts stand China mit dem großen Führer des Proletariats, Mao Tse-Tung. Daneben gleich das Vaterland des Proletariats, die Sowjetunion mit ihren 12, oder waren es sogar 14 Zeitzonen?, und natürlich mit Stalin, der sogar der Hirse das Wachsen beigebracht hatte, wie Herr Kühn sagte. Das hatte er von einem berühmten Dichter, den er aber wohl nicht so mochte. Man sah’s an seinen heruntergezogenen Mundwinkeln, wenn er dessen Namen erwähnte. Aber vielleicht mochte er auch nur keine Hirse. Ich übrigens auch nicht. Oma Martha, die in unserer Wohnung ein halbes Zimmer bewohnte, machte sie manchmal für sich, wenn nichts weiter da war. Sie wollte mir dann auch immer etwas abgeben, um mir etwas Gutes zu tun, wie sie sagte. Ich nahm aber nichts, was sie mit einem resignierten Blick quittierte. Nach der großen Sowjetunion kam schon die Deutschlandkarte mit Rügen und Rhein und Bonn, wo sich die Bonner Ultras eingenistet hatten. Ganz links kamen dann die USA, mit den unterdrückten Negern, Kriegstreibern, Indianern, Cowboys und natürlich Elvis. Noch weiter links standen ein paar Landkarten, die er uns nie gezeigt hat. Sie sahen brüchig und verstaubt aus. Auf einer konnte ich ganz oben rechts noch “hland 1914” sehen. Obwohl ich gern gewusst hätte, was das für Karten waren, habe ich sie nie aufgerollt, selbst wenn ich allein im Kartenzimmer gewesen bin.
Nachdem Frau Herrlich auch im Flur nicht mehr zu sehen war, hing so etwas wie ein Summen im Klassenzimmer. Einige Jungs und auch ein paar Mädchen liefen in den Gängen zwischen den Bankreihen herum, hüpften von links nach rechts oder umgekehrt über ihre Bänke und eckten einander an. Atze war am schlimmsten. Er rannte Monika hinter her. Die anderen kramten nach Bleistiften, Heftern, Radiergummis, oder was auch immer, wie unbeteiligt in ihren Schultaschen oder sahen angestrengt aus dem Fenster. Janno sah sich die ganze Szene wie unbeteiligt von seiner Bank aus an. Da fuhr wie jeden Tag die Neun-Uhr-Fünfer vorbei. Man konnte sie zwar nicht sehen, aber gut hören, weil unsere Schule gleich neben der Straßenbahnhaltestelle lag. 9:05, 9:15, 9:25. Bis 9:50 hielt alle 10 Minuten eine, dann nur noch alle 20 Minuten. So konnten wir uns wenigstens über die langweiligsten Stunden hinweg zeitlich orientieren. Wie z. B. in Mathe. Manchmal wetteten wir, ob die 9:45iger zu spät kommen und genau dann quietschend anhalten würde, wenn um 10 vor zehn die Klingel im Flur laut den Beginn der Pause ankündigte. Die Gewinner bekamen dann von den anderen je eine Zigarette, die sie entweder auf der Toilette oder während der Mittagspause auf dem Schulhof pafften, was natürlich nicht erlaubt, aber sehr beliebt war.
Rechts hinter mir redeten Kalle und Gerd mit gepressten Stimmen auf einander ein. Es musste ein wichtiges Thema sein. Warum redeten die eigentlich nicht auch mit mir? Ich drehte mich aber trotzdem zu ihnen um. Ihre Wangen waren ganz rot, und auf Gerds Stirn bildeten sich kleine Schweißperlen. Leider verstand ich nicht genau, was sie sagten, weil zu Viele in der Klasse quatschten oder sonst wie laut waren. Gerd machte mit seiner rechten Hand eine Art offene Faust, die sich rhythmisch von oben nach unten bewegte, wobei er Kalle ein wenig prahlerisch ansah. Und dann hörte ich ihn sagen, dass da, wobei er auf seinen Sack zeigte, so eine dicke weiße Flüssigkeit rauskäme. Was für eine Flüssigkeit, wo raus? Wenn man pinkeln geht, kommt doch nichts Weißes raus, dachte ich, drehte mich wieder um und holte mein Deutschbuch aus der Schultasche. Irgendwie schämte ich mich für sie. Nur gut, dass Gitta diese Gesprächsfetzen nicht mitbekommen hatte. Gitta war nämlich ganz anders als die anderen Mädchen, viel netter und zarter, fand ich. Sie hatte meist einen dunkelblauen Rock an, den sie zu ihrer weißen Pionierbluse und dem blauen Halstuch trug. Seit Anfang der 8. zog sie auch öfter einen schwarzen oder rosa Pullover über ihre Bluse. Das blaue Halstuch, selbst wenn sie eins anhatte, war dann natürlich nicht zu sehen. Gitta mochte mich auch, bildete ich mir ein. Warum würde sie sonst freiwillig neben mir sitzen. Manchmal ließ sie mich sogar abschreiben, obwohl das eigentlich gegen ihre Ehre als Thälmannpionierin ging.
Fast noch schlimmer als Mathe war Deutsch für mich, jedenfalls heute, denn eigentlich las ich Geschichten und Romane sehr gern, besonders wenn sie spannend waren. Aber bis heute hätten wir drei Kapitel aus einem russischen Roman, lesen sollen. Wie der Stahl gehärtet wurde, hieß er. Mir fehlten aber noch immer die letzten Seiten, weil ich gestern einfach nicht zum Lesen gekommen war. Mir war deshalb mulmig zu Mute, weil Kühn mich oft aufrief. Zum Beispiel, wenn niemand auf seine Fragen reagierte, zeigte er mit seinem langen schlanken Zeigefinger meist auf mich und fragte ironisch: “Na, hat unser Literaturspezialist dazu eine Meinung?” Meist konnte ich etwas sagen, nicht, dass ich damit bei den anderen beliebt geworden wäre, aber heute? Ich hätte wie dumm dagestanden. Wenn ich nur gewusst hätte, wie das mit Pawel und Rita in dem überfüllten Zug ausgegangen war.
Die Sorge hatte Atze offenbar nicht. Der lief noch immer hinter Monika her. Aber die war schneller, lachte, sprang über den Sitz der Bank vorne links, lief um die nächste herum und dann rechts um die Ecke. Doch dann verfing sie sich mit ihrem Rocksaum an einer scharfen Kante und fiel mit ihrem Rücken auf den Sitz der nächsten Sitzbank. Atze landete wie aus Versehen genau auf ihr und wollte sie küssen. Aber Monika schupste ihn lachend zur Seite. Schnell sammelte sich eine kleine Gruppe um die beiden. Irgendwie hatte sich Monikas Rock nach oben verschoben, so dass der Saum ihres grünen Schlüpfers zu sehen war. Atze versuchte es mit dem Küssen noch einmal, was Monika erneut zum Lachen brachte. Schließlich bewegte er sich rhythmisch auf ihrem Bauch hin und her, und nun hörte Monika mit ihrem Lachen auf, denn die Bank unter ihrem Rücken war sicher ganz schön hart. Neben mir stand auf einmal Gitta. Unwillkürlich nahm ich behutsam ihre Hand in meine. Sie bekam einen ganz roten Kopf, zog ihre Hand langsam zurück, blieb aber neben mir stehen.
Janno wurde Atzes hin und her rutschen auf der Bank offenbar zu viel. “He, ich hatte dir doch gesagt, du sollst an die Tür”, schrie er ihn an. Atze wagte nicht zu widersprechen. Gehorsam ging er zur Tür, während sich Monika aufrappelte und sich lässig auf ihre Bank zurückzog. Dann kramte sie einen Lippenstift aus ihrer Schultasche und begann, sich ihre Lippen zu bemalen, wobei sie ab und zu auf ihren rot gerahmten Taschenspiegel sah.
“Wo hast Du denn den Lippenstift her?”, fragte Heidi.
“Na von wo schon, von Wertheim!”
“Und das Westgeld dafür?”
“Brauchst de da nicht. Du lässt Dir ‘n paar zeigen, und einer verschwindet dann einfach in Deiner Tasche.”
Heidi kuckte sie bewundernd an.
“Wirklich? Und wenn sie Dich nun kriegen?”
“Passiert nicht viel. Wenn die merken, dass Du aus’m Osten bist, schmeißen sie Dich einfach raus. Und das isses dann. Viel können se ja sowieso nicht machen. Einmal hat mir ‘ne Verkäuferin sogar einen geschenkt. Der war zwar schon leicht gebraucht, hab ihn aber trotzdem behalten, weil er ‘ne ganz tolle, hellrote Farbe hatte und nicht so schmierte.”
“Und an der Grenze?”
“Ach die Vopos. Für die bin ich doch total uninteressant. Die sind jetzt viel zu beschäftigt mit Leuten, die mit Rucksäcken in den Westen nach Mariendorf fahren. Wahrscheinlich ‘n paar idiotische Zonenbauern, die abhauen wollen. Dass die sich nicht denken können, dass man, wenn man abhauen will, nicht mit Rucksäcken in den Westen fährt.”
Jetzt rannte Janno Heidi hinterher. Von der wollte er schon lange was, das war allen klar. Sie hatte den größten Busen in der 8c. Gerd lief ihr von der anderen Seite entgegen. Heidi rannte so schnell sie konnte um die mittlere Bankreihe herum. Doch die zwei stellten sie in der Mitte. Gerd hielt sie fest. Janno schob seine Hand unter ihre Bluse. Gerd machte sich unter ihrem Rock zu schaffen. Anfangs wehrte sie sich und versuchte, die beiden von sich zu stoßen. Einmal gelang es ihr sogar, Gerd mit ihren Fingernägeln das Gesicht so zu zerkratzen, dass er anfing zu bluten. Doch das schien ihn nicht zu stören. Schließlich hielt sie wie ein ermüdetes Tier inne, sich zu wehren und sackte auf dem Boden zusammen. Niemand, der um sie Herumstehenden sagte ein einziges Wort. Auch Heidi blieb eine scheinbare Ewigkeit stumm. Langsam lief ihre schwarze Augenschminke von den Wimpern aus über ihre Wangen, und ihre Schultern begannen zu zucken, während sie sich mit beiden Armen auf dem braunen Linoleumfußboden abstützte. Schweigend ließen Janno und Gerd von ihr ab und gingen zu ihren Bänken. Gitta und ich standen mit ein paar anderen weiter hinten und taten so, als hätten wir nichts bemerkt. Gittas braune Augen hinter ihrer Brille füllten sich mit Tränen. Sie drehte sich von mir weg und ging auf ihren Platz. Ich musste unwillkürlich schlucken.
Auf einmal rief Atze: “Kühn kommt, Kühn kommt”, und dann schrillte auch schon die Klingel. Herr Kühn kam herein. Wir sprangen auf und stellten uns neben unsere Bänke.
“Guten Morgen”, grüßte er.
“Guten Morgen, Herr Kühn”, erwiderten wir.
“Setzt euch!”
Herr Kühn setzte sich heute nicht auf seinen Stuhl, sondern auf den Lehrertisch. Aus irgendeinem Grund war er wohl guter Laune. Man sah es an seinem ironischen Lächeln und an der roten Nelke im Revers seines hellen Sakkos. “Der war gestern wieder im Westen, am Kudamm”, flüsterte Monika ihrer Banknachbarin Petra zu. Die kuckte nur fragend.
“Na, der hat da doch ‘nen Freund.”
“Und woher weißt Du das?”
“Ich hab die mal gesehen”, antwortete Monika. Meine Güte, dachte ich, entweder weiß Monika wirklich alles oder die spinnt.
Herrn Kühns gute Laune brachte uns wieder Mal eine Sternstunde, denn nun konnten wir ihn ablenken, indem wir ihn dazu überredeten, uns etwas vorzusingen. Herr Kühn nahm nämlich Gesangsunterricht. Das fanden die meisten von uns ziemlich albern, Opernsänger wollte er eigentlich einmal werden. Was das schon war! Aber sein Gesang verkürzte die Unterrichtsstunde, und manchmal gefiel es uns auch, wie er sich in Pose warf und dann sein Lieblingslied sang. Darüber mussten wir natürlich lachen, doch er überging das dann immer und sang einfach weiter.
Katrin schnippte mit den Fingern. “Ja bitte, Katrin, was gibt’s denn?”
“Herr Kühn, Herr Kühn, könnten Sie uns nicht das Lied von der Forelle vorsingen? Bitte!”
“Na ja, eigentlich wollten wir ja über Pawel Kortschagin und Rita sprechen. Aber, na gut, weil heute das Wetter so schön ist”, lächelte er ironisch.
Herr Kühn stellte sich aufrecht vor den Lehrertisch, warf seinen Kopf nach hinten, Kinn nach oben, atmete tief durch und begann:
“In einem Bächlein helle,
Da schoss in froher Eil
Die launige Forelle
Vorüber wie ein Pfeil. […]”
Beim Wort Pfeil angelangt, fing er an, wiegend durch die Bankreihen zu gehen, wobei er sich bei den Reimwörtern in der dritten Strophe “Rute” und “kaltem Blute” besonders den Jungs zuwandte. Die meisten lachten an dieser Stelle, aber mir wurde traurig zu Mute. Am Ende klatschten wir natürlich alle und wollten ihn zu einer Wiederholung oder einem “da capo”, wie er es nannte, verlocken, aber jetzt ließ er nicht mehr mit sich reden.
“Nehmt bitte Eure Deutschbücher heraus. Bis heute solltet Ihr bis zu der Stelle lesen, an der Pawel und Rita im überfüllten Zug zu einer wichtigen Konferenz fahren müssen. Kann mir jemand erklären, worin die Bedeutung dieser Stelle liegt?”
Großes Schweigen. Niemand meldete sich. Auch sein Musterschüler für Literatur, Karsten, nicht. Also behalf er sich, glücklicherweise, indem er Janno bedeutete, er solle doch mal folgenden Abschnitt vorlesen. Und Janno las:
Für ihn war Rita unantastbar. Sie war seine Freundin, seine Genossin im Kampf, sein politischer Leiter. Dass sie auch eine Frau war, hatte er zum ersten Mal heute auf der Brücke empfunden, und deshalb erregte ihn diese Umarmung sehr. Pawel spürte ihre tiefen, gleichmäßigen Atemzüge, irgendwo ganz nahe waren ihre Lippen. Diese Nähe erweckte in ihm den unüberwindlichen Wunsch, ihre Lippen zu suchen, und nur mit äußerster Willensanstrengung konnte er sich bezwingen.
Herr Kühn wandte sich nun noch einmal an die Klasse. “Was will uns der Autor Ostrowski mit diesen Sätzen sagen. Und hier möchte ich besonders von den Herren der Schöpfung hören.” Fragend sahen wir einander an. Janno schien sogar bestürzt. Nur Atze konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Was wusste Kühn? Ich schaute Brigitte an, deren Gesicht schon wieder zu glühen schien. Da war der Zeigefinger, und der deutete direkt auf mich. “Herr Wegner, Sie wollten etwas sagen?” Ich stand auf. Eigentlich nicht, dachte ich. In meinem Kopf wirbelten die Gedanken durcheinander. Verzweifelt suchte ich nach einer Antwort. Was konnte ich nur antworten? “Na ja, das war doch eine revolutionäre Situation”, fiel mir gerade noch ein. So ein Satz stimmte immer, dachte ich mir, “und Pawel und Rita mussten doch beide zu einer wichtigen Parteikonferenz fahren, und da kann man doch nicht, ich meine…” Was meinte ich nur? Weder wusste ich die Antwort, noch konnte ich genau verstehen, worum es eigentlich ging. Kühn musste meine Not bemerkt haben und lächelte mir aus den Augenwinkeln zu. Ich begann zu schwitzen. “Der Autor sagt doch, dass Rita eine Genossin, also eine Kommunistin, ist, da kann man doch, da kann man doch nicht an ihre Lippen, ich meine, da muss man doch an die gemeinsame Sache denken, fiel mir gerade noch ein. “Sehr richtig, setzen Sie sich, Karsten”, beendete Kühn mein Gestammel. “Und die anderen, was meinen die anderen”, fuhr Kühn fort. Doch die anderen schwiegen weiter verlegen oder grinsend oder tuschelten mit ihren Banknachbarn. Da quietschte und kreischte es auf der Straße wie Metall auf Metall, und gleichzeitig klingelte es zur Pause. Die 9:Uhr 45ger. So ein Pech, dachte ich, gerade heute hatte ich nicht gewettet.
“Na gut”, sagte Herr Kühn, “die Pause muss man ehren. Dafür schreibt Ihr mir bis Donnerstag einen dreiseitigen Aufsatz zur Darstellung der Liebe in dem Buch Wie der Stahl gehärtet wurde. Ach, und noch etwas, ich möchte Sie daran erinnern, dass am Sonntag um 14 Uhr Ihre Jugendweihe im ‘Theater der Freundschaft’ an der Parkaue stattfindet. Bitte pünktlich erscheinen, wenn ich bitten darf. Das ist ein wichtiger Wendepunkt in Ihrem Leben.”
Am 31. April 1961 war der Wendepunkt da. Ab heute morgen war ich ein Erwachsener. Noch merkte ich aber nichts davon. Es war noch früh und ein Sonntag wie alle anderen Sonntage, langweilig. Mutti und Vati ließen mich wie jeden Sonntag, etwas länger schlafen, d. h. eigentlich schlief ich nicht, sondern versuchte, mir auszumalen, wie mein Leben als Erwachsener sein würde. Auf jeden Fall mehr Verantwortung, hatte uns ein Herr Schmidt von der Jugendweihekommission in den Vorbereitungsstunden erklärt. Aber was bedeutete das?
Während ich noch darüber nachgrübelte, hörte ich Vati im Badezimmer ein paar Holzstücke und Kohlen in den kleinen Ofen unter den Wasserboiler legen. Normalerweise wurde ja immer Sonnabend gebadet. Erst Mutti, dann Vati, und dann kam ich dran. Wann hat eigentlich Oma gebadet, überlegte ich. Fiel mir aber nicht ein. Aber in dieser Woche war alles auf den Wendepunkt in meinem Leben verlegt worden, und heute ließ man mir deshalb auch den Vortritt. Trotzdem musste ich nicht gleich aufstehen, denn ich hatte noch mindestens eine halbe Stunde Zeit. Solange dauerte es nämlich, bis das Wasser im Boiler heiß war. Also schnell noch mal die Bettdecke über den Kopf gezogen und an das Erwachsensein gedacht. Doch schneller als erwartet rief Mutti mit ihrer süßesten Stimme, fast tirilierte sie: “Karsten, aufstehen, das Badewasser ist fertig.” Und dann stimmte auch Vati mit dunkler und kraftvoller Stimme ein: “Reise Reise!” Das “Reise, Reise” hatte er von seinem Vater, der Kapitän auf einem Küstensegler gewesen war. Vati liebte diese Seemannsausdrücke. Na gut, dachte ich, Reise, Reise, Aufsteh’n. Langsam ging ich ins Badezimmer, ließ die Hälfte des Wassers in die Wanne und drehte dann die Dusche auf.
“Mutti”, rief ich in Richtung Küche, “jemand muss mir mal den Rücken waschen. Das Badezimmer lag gleich neben der Küche. Mutti hatte mir immer den Rücken gewaschen. Nur in den letzten Monaten war sie oft verhindert gewesen. “Das kannst Du doch allein machen”, rief sie zurück. “Nö, ich komm da nich ran”, antwortete ich. Eigentlich war mir dieses Rückenwaschen schon seit einiger Zeit peinlich, weil ich beim Waschen öfter einen halben Steifen bekam. “”Nen Steifen haben” war was Peinliches. Aber nicht den Rücken gewaschen zu bekommen war unhygienisch. Munter rief ich: “Das Wasser wird kalt!”
Als sie ins Badezimmer kam, drehte ich mich vorsichtshalber mit dem Rücken zu ihr. Sie seifte den Schwamm ein und begann meinen Rücken zu schrubben, danach mein Genick und auch meine Achselhöhlen. “Aua, nicht so hart”, rief ich. Sie versuchte es etwas sanfter. Plötzlich sagte sie: “Mach mal allein weiter. Ich muss in die Küche, sonst brennen mir die Bratkartoffeln an.” Ich drehte mich halb zu ihr um und war erleichtert, sie aus dem Badezimmer gehen zu sehen. Außerdem waren Bratkartoffeln mit Speck und Ei mein Lieblingsfrühstück, und die sollten auf keinen Fall anbrennen. Schnell noch das Haar gewaschen, gespült und dann in mein Zimmer zum Anziehen. Der Tag fing eigentlich gut an.
Auf dem Bett lag mein neuer, blaugrauer Anzug. Mein erster. Dazu noch maßgeschneidert. Mutti kannte noch einen privaten Schneider — viele gab es ja davon nicht mehr –, der gleich um die Ecke wohnte. Neben dem Anzug lagen ein Paar neue Unterhosen, ein weißes Hemd, eine rote Fliege, schwarze Socken und meine alten braunen Schuhe auf Hochglanz poliert. Da hatte Vati sicher eine halbe Stunde lang gewerkelt. Neue kaufen, wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, aber die gab es jetzt kaum. Und wenn, dann waren sie zu teuer oder in einer falschen Größe. Die Hamsterer aus dem Westen, die im Osten alles billiger aufkauften, hatten wohl mal wieder zugeschlagen. Man konnte so etwas öfter in der BZ am Abend lesen.
Nach dem Frühstück ging Vati zum Wohnzimmerschrank, wo das gute Geschirr aufbewahrt wurde, und kam mit einer Flasche Adlershofer und zwei kleinen Gläsern zurück. Ich schaute ihn ungläubig an. Zu Sylvester heimlich Eierlikör aus den noch halbvollen Schnapsgläsern der Erwachsenen zu schlecken, war mir nicht fremd, aber Adlershofer mit Erlaubnis, das war schon etwas anderes. Vati füllte sie, aber nur für uns beide. “Na nimm schon”, drängte er, “heute ist doch ein wichtiger Tag für dich. Also auf den neuen Erwachsenen”, sagte er mit würdevoller Stimme. Vorsichtig nahm ich das Glas und trank einen Schluck. “Na ex”, sagte Vati. Mann, wie das brannte! Ich atmete tief ein. “Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Iss ein Stück Brot hinterher”, sagte Vati lächelnd.
Kurz vor zwei waren wir alle vor dem “Theater der Freundschaft”. Ich meine, wirklich alle. Oma und ihre Tochter, Tante Hete, mit ihrem Mann, Karl, die zusammen in der Britzer Fritz-Reuter-Allee wohnten, und Onkel Otto mit seiner Frau Anna aus Neukölln. Selbst Muttis Schwester Gretel war extra aus Düsseldorf gekommen. Von den Ostlern waren eigentlich nur Vatis Bruder Paul und seine Frau Trude da. Vatis und Muttis Freunde hatten sich entschuldigt, was für mich kein großer Verlust war, denn selbst wenn sie mal zu meinem Geburtstag bei uns waren, gab es keine Geschenke. Also wären auch heute keine zu erwarten gewesen.
Neben unserer Familiengruppe standen die Schüler der anderen achten Klassen mit ihren Verwandten. Wir Jungen trugen zum ersten Mal einen richtigen Anzug mit Schlips oder Fliege. Die Mädchen knickten mit ihren Stöckelschuhen um und trugen ihre ersten seidenen Strümpfe mit der Naht auf der Rückseite ihrer meist sehr dünnen Waden. Dazu lange Kleider oder weite Röcke, Pettycoats, wie sie gerade Mode waren und weiße Blusen. Einige Mädchen trugen noch ihren Pferdeschwanz, die meisten jedoch hatten ihre Haare mit Haarspray und Lockenwicklern hoch frisiert und kamen mir daher vor allem fremd vor.
Punkt zwei Uhr winkte uns Gerlach, der Direktor unserer Schule, in den Eingang des “Theaters der Freundschaft”, geleitete uns in den Zuschauerraum und wies uns in unsere Bankreihen ein. Die Jungs aus der 8c mussten dabei lachen. Wir erinnerten uns noch gut an die Anweisung von Herrn Kühn, der uns beschworen hatte, an den schon Sitzenden mit dem Gesicht zugewandt vorbeizugehen, denn wenn man ihnen den Rücken zukehrte, könnte einem ja mal was Menschliches passieren, und das wäre dann furchtbar peinlich. Doch heute waren wir alle, ohne Peinlichkeiten zu verursachen, an unsere Sitze gelangt. Alle Schüler setzten sich in die ersten Reihen, dann kamen die Lehrer und schließlich die Verwandten. Zuerst gab es eine Begrüßung durch einen Schulrat. Was der wohl mit uns zu tun hatte? Dann machte ein kleines Orchester Musik: Geigen, Klavier, Cello, und, ich glaube sogar, ein paar Trommeln und eine Pauke. Schließlich kamen alle möglichen Leute auf die Bühne, gingen hinter das Rednerpult. Gerlach und Herr Kühn hielten etwas längere Reden. Besonders bei Gerlach ging es überwiegend um unsere Treue zum Arbeiter- und Bauernstaat, um die Verteidigung seiner Errungenschaften, vor allem aber um unsere Pflichten im Kampf für den Sieg des Sozialismus. Klar, dass dazu die Bonner Ultras in Schach gehalten werden mussten, damit sie nicht durch das Brandenburger Tor marschieren konnten, um unser sozialistisches Gesellschaftssystem zu beseitigen, unseren Genossenschaftsbauern das Land wegzunehmen und es den Junkern zurück zu geben. Am Schluss sprach Kühn. Ich glaube, er zitierte Schiller[T1] oder Goethe, Klassiker eben, deren Erben wir sein sollten:
“Immer strebet zum Ganzen.
Und kannst Du nimmer ein Ganzes werden
Als dienendes Glied
Bind an ein Ganzes Dich an.“
Er zitierte nicht ohne Pathos, aber auch nicht ohne Ironie. Merkwürdig. Schließlich waren diese Goethe und Schiller doch schon lange tot, und ich dachte eigentlich, Pawel und Rita sollten unsere Vorbilder sein. Überhaupt, ich hasste dieses Wort Erbe, und das Wort Vorbild auch. Ständig wurden wir mit der Frage gelöchert, wer denn nun unser Vorbild war. Und jetzt sollten wir noch ein Ganzes werden oder uns wenigstens an das Ganze anbinden? Waren Erbe, Vorbild und das Ganze identisch? Vielleicht war das Ganze die “große gemeinsame Sache” oder die FDJ oder die Partei. Vielleicht mussten wir uns ja wirklich irgendwo anbinden, denn wie sollten wir so ganz allein zu einem Ganzen werden; das konnten nur Genossen wie Stalin oder Walter Ulbricht. Thälmann hatte es sicher auch zu einem Ganzen geschafft, aber wir?
Schließlich wurden wir alle auf die Bühne gerufen und mussten dann, wie schon bei der Aufnahme in den Verband der Jungen Pioniere, etwas geloben. Es gab zehn Grundsätze, die wir unserem Direktor nachsprechen und mit einem „Ja, das geloben wir!“ bestätigen sollten. Was wir da auf der Bühne versprachen, ist mir leider entfallen. Was werden die Westberliner zu diesem Gelöbnis gesagt haben? Mir war das Ganze ihretwegen peinlich. Aber die Britzer und Neuköllner lächelten nur aufmunternd. Wahrscheinlich dachten sie sich ihren Teil. Gesagt haben sie mir zur sozialistischen Weihe jedenfalls nichts. Am Ende der Veranstaltung bekamen wir noch ein Buch geschenkt. Es hieß Weltall, Erde, Mensch, ein Buch, das ich aber schon hatte, weil es mir Onkel Paul und Tante Trude schon zu Weihnachten geschenkt hatten, worüber ich mich noch heute ärgere. Die hätten mir ja auch mal was Ordentliches schenken können. Und wenn schon ein Buch, dann wenigstens einen Karl May, den ich noch nicht hatte. Haben sie aber nie.
Nach dem Festakt liefen wir alle zu unserer Dreieinhalb-Zimmer-Wohnung in der Ruschestraße, wo schon Oma Martha auf uns wartete, weil sie wegen ihrer geschwollenen Füße nicht zum “Festakt” mitgekommen war und stattdessen ein paar Schnitten für alle zubereitet und den Tisch gedeckt hatte. Als wir alle im Wohnzimmer standen, bat Vati alle mit einem Glas Wein auf mich anzustoßen. Selbst ich war zu meiner Verwunderung in diese Aufforderungen einbezogen. Doch nun kam das Beste. Onkel Otto zog mich in mein kleines Zimmer und gab mir ein kleines Päckchen. “Na, mach schon auf”, ermutigte er mich. Es war ja ein bisschen klein für einen Wendepunkt in meinem Leben. Aber neugierig war ich natürlich doch. Ich packte also aus und brachte eine wunderschöne braune Lederbrieftasche zum Vorschein. Ich schaute sie mir an und betastete sie: ganz weich. Ich war glücklich. Ein Erwachsener brauchte eine Brieftasche. Und nun hatte ich eine so weiche, lederne. “Nun mach die doch mal auf”, forderte mich Onkel Otto noch einmal auf. Inzwischen hatten sich schon andere Verwandte um uns gescharrt. Ich guckte mich um. “Mach auf, mach auf”, riefen die anderen. Eigentlich wollte ich sie ja ganz alleine aufmachen, um ganz alleine meinen neuen Reichtum zu bestaunen, aber na ja, es ging eben nicht. Also machte ich sie auf, und da lagen doch wirklich fünf neue Zehn-Mark-Scheine, Westmark, wohlgemerkt, in einem der Seitenfächer. Ich machte große Augen. Damit konnte man drüben beim KDW mindestens fünf Pfund Kaffee kaufen, vom Guten. Aber nun kamen ja noch die anderen, die Britzer, die meine Brieftasche weiter auffüllten. Am Ende muss ich fast 100 DM gehabt haben. Mutti staunte nicht schlecht. “Hundert Westmark, wenn ich die umtausche, kriege ich so viel wie das Monatsgehalt deines Vaters”, sagte sie bewundernd. Ich war stolz, ein Gefühl, in das sich sofort ein wenig Angst mischte. Sie wollte doch nicht etwa mein Westgeld umtauschen. Ich wollte ihr doch etwas Schönes vielleicht ein paar gute Stückchen Seife kaufen, die Westseife roch ja immer so gut. Außerdem wollte ich mit Gitta noch drüben ins Kino gehen. Da wurde gerade Windjammer auf Breitwand im Europa Center gespielt. Janno, Monika, Atze und Heidi hatten den Film schon gesehen und fanden ihn toll. “Mann, diese geblähten Segel, die hohen Atlantikwellen mit der weißen Gischt, und wie die Matrosen in den Mast kletterten. Das wär mal was,” meinte Janno.
Der Festakt ging dann mit Kaffee und Kuchen weiter. Später gab es die von Oma gemachten Schnitten, die sie mit Jagd- und Leberwurst belegt hatte. Danach gab es Likör für die “Damen” und für die Männer Bier und Adlershofer Wodka, den Onkel Otto Russenschnaps nannte, was ihm aber keiner übel nahm, weil er nämlich, so zu sagen als Entschuldigung noch Whisky und echten französischen Cognac aus seiner Aktentasche auspackte. Dieser Teil der Familienfeier dauerte lange, für mich viel zu lange. Daraus wurde nämlich ein langes Besäufnis, das Tante Trude auf ihrer Klampfe mit Liedern aus der Wandervogelzeit begleitete. Die anderen fanden ihr Klimpern und ihren Gesang irgendwie aufmunternd, denn sie stimmten beim Nachfüllen der Gläser immer wieder mit ein, wenn auch nur in die Anfänge der ersten Strophen. Nur Tante Gretel hielt sich fern und setzte ihr vornehmes Gesicht auf. Als Düsseldorferin und Chefsekretärin war ihr diese Berliner Verwandtschaft zu proletarisch. Lange hielt es Tante Trude aber bei den “Drei Zigeunern” , der “Wahren Freundschaft” und in “In einem tiefen Wiesengrunde” nicht aus, weil Onkel Karl eine ganze Packung einzeln eingewickelter Zigarren mitgebracht hatte, deren blauer Qualm sie ständig zum Husten brachte. Tante Trude wollte mal Sängerin werden,, hatte Mutti mir einmal erzählt. Doch bei diesem Rauch klang ihre Stimme ein wenig dünn und krächzend.
Am interessantesten waren noch die Gespräche, obwohl es eigentlich auch immer die gleichen waren. Mutti erlebte ihren 21. Geburtstag wieder im großen Luftschutzkeller des Flakturms am Friedrichshain, Hete und Vatis Mutter, die auch Hete hieß, und Onkel Karl wurden im Dezember 1943 am Wedding ausgebombt und konnten noch von der Straße aus sehen, wie eines ihrer Lieblingsgemälde, Opas selbstgemaltes Bild seines Küstenseglers, brennend von der Wohnzimmerwand fiel, Vati versteckte sich in den letzten Wochen des Krieges vor den Kettenhunden der Wehrmacht und der SS in einem Keller, und Onkel Paul zog mit einem Pferdefuhrwerk — wo er das nur her gehabt hatte? — kurz nach Kriegsende nach Berlin, bereit, jeden der ihm das Pferd klauen wollte, mit seiner 08 zu erschießen. Glücklicherweise wollte aber keiner. Nachdem sie das Thema Krieg hinter sich gelassen hatten, ging es noch weiter rückwärts. Die Britzer und Neuköllner kamen nämlich aus der alten Vor-33iger-SPD, während Vati und Onkel Paul 1930 in die KPD eingetreten waren. “ Als der Reichstag brannte, hätten wir losschlagen sollen. Die Waffen hatten wir ja”, sagte Onkel Paul. “Die lagen nämlich in unseren Bootshäusern, zum Beispiel bei uns, im Ruderklub “Freiheit”. Wenn wir da entschlossen zugeschlagen hätten, hätten wir die ganze braune Scheiße nicht jekriegt.” “Ihr Idioten, dann hätten wir die rote jehabt”, schrien Karl und Otto. “Ihr Kommunisten habt doch die Republik verraten. Für Euch waren wir doch Feinde, Sozialfaschisten, und beim BVG-Streik habt ihr mit den Nazis gemeinsame Sache gemacht, oder?”
Oh, oh, das konnte heiß werden, dachte ich. Aber Tante Hete rettete die Situation, indem sie den Männern vorschlug, doch noch einen zu trinken, was die auch willig taten. Onkel Paul schlief kurz darauf ein, nicht ohne zu sagen, was er bei diesem Stand seines Besäufnisses mit weinerlicher Stimme bei Familienfeiern immer von sich gab: “Dass die Partei unseren Teddy nicht besser geschützt hat, das werde ich ihr nie vergessen.”
Vergessen jedoch waren ich und mein großer Wendepunkt. Daher verzog ich mich unbemerkt ins Bett. Doch mit Einschlafen war nicht viel. Ich dachte an Gitta und nahm mir vor, irgendwann in den nächsten beiden Wochen mit ihr ins Europa Center zu gehen, um uns Windjammer anzusehen. Hinterher vielleicht Eis bei Kranzler, das ich ihr lässig mit dem Jugendweihegeld spendieren konnte. Und danach? Ich war mir nicht sicher, aber ich wollte mal bei Kalle nachfragen, wie man ein Mädchen küsst. Sicher wusste er das. Aber ob Gitta das wollte? Auf einmal kam dann dieses Geräusch. Es dauerte eine Weile, bis mir klar wurde, dass Tante Gretel auf einer Liege in Oma Marthas Zimmer schnarchte. Regelmäßig und sehr laut, so dass es durch zwei Türen bis zu mir vordrang. Ab und zu setzte es aber auch aus, und dann hörte ich etwas, was so klang, als würde sie sich verschlucken. Wenn sie sich nur mal richtig verschlucken würde, dachte ich, dann würde sie vielleicht aufhören, mit ihrem Nasenerker, — Nasenerker war auch ein Lieblingswort von Vati — solchen Krach zu machen. Aber auch aus dem Wohnzimmer kamen noch Geräusche, weil die Britzer, Neuköllner und Adlershofer nicht ohne Grund noch da waren. Denn erstens fuhren S- und U-Bahnen nicht mehr, und zweitens ging Onkel Paul sowieso immer erst, wenn auch die letzte Flasche leer war. Leider hatte aber, als ich ins Bett ging, noch eine halbe Adlershofer auf dem Tisch gestanden, vom Berliner Pilsner, das Vati “nur für den Notfall” in der mit kaltem Wasser gefluteten Badewanne gelagert hatte, ganz zu schweigen.
Nach mehrmaligem Besingen des jungen Stiefels, der leider sterben musste, griff Tante Trude noch einmal zur Klampfe und versuchte, ihren Mann durch weiteres Singen wenigstens vom Wodka abzuhalten. Gleich am Anfang war diesmal “Hoch auf dem gelben Wagen” dran, in das selbst die Britzer noch einstimmten. Tante Trude wollte mit dem Lied natürlich an Abschied und Heimgehen erinnern. Immerhin war es inzwischen ja schon fast Morgen, aber Onkel Paul muss an anderes gedacht haben, denn mitten im Lied, als es hieß “statt der Peitsche die Hippe”, schien seine Stimme leiser zu werden. Doch dann verlangte er laut von seinem Bruder, er solle ihm sofort noch ein großes Glas Adlershofer rüberreichen. Irgendwann muss ich dann zwischen Singen und Schnarchen doch noch eingeschlafen sein.
Leider kam es zu meinem erträumten Kinobesuch nicht mehr. Das lag an Gittas Eltern. Am ersten Mai waren wir noch zusammen mit den Lehrern und Schülern unserer Schule über den Marx-Engels-Platz marschiert. Es war erster Mai, der Feiertag der Werktätigen. Und mindestens eine Million Ostberliner und ihre Westberliner Genossen von der SED und KPD demonstrierten an der Ehrentribüne vorbei. Gitta hatte wieder ihren blauen Rock und ihr weißes Pionierhemd an. Ihr blaues Halstuch bewegte sich sachte im Wind, und ihr Pferdeschwanz, den sie mit einem bunten Gummi am Hinterkopf zusammengezogen hatte, wippte beim Marschieren hin und her. Aber diesmal hatte sie keine Brille auf, weil sie die ja nur zum Lesen brauchte, und heute brauchte man nicht lesen. Die vielen Transparente interessierten eigentlich niemanden, und außerdem waren überall Lautsprecher installiert, durch die ein sehr begeisterter Sprecher alles erklärte, was man sowieso um sich herum sah. Na ja, nicht alles, wie z. B. die Planerfüllungen und die Ernteerfolge der Genossenschaftsbauern vom vergangenen Jahr, wie die Frühjahrssaat jetzt so viel schneller ging, da alle Bauern sich in LPGs organisierten; und wie immer klang die begeisterte Stimme aus den Lautsprechern auf einmal entrüstet und drohend, als sie das gefährliche Treiben der Bonner Ultras, der Saboteure und der Agenten des Imperialismus verdammte.
Gitta ist einfach schön, dachte ich und konnte nicht aufhören, hoffentlich unbemerkt, sie von der Seite anzusehen. Sie sah so, mir fiel nicht gleich das richtige Wort ein, sie sah so frisch aus, so mit einem lächelnden, offenen Gesicht. Heute hatte sie keinen Pullover über ihre weiße Bluse gezogen. Es war ja auch schon warm. Ich stellte mir vor, wie sie in ein paar Tagen von Windjammer und Eis begeistert nur noch mich sehen würde. Aber wo würde ich sie küssen, und vor allem wie? Kalle war doch keine richtige Hilfe gewesen. Der schwafelte nur was von französisch küssen, aber was das war, wusste er auch nicht.
Am Dienstag saß ich allein auf unserer gemeinsamen Schulbank. Vielleicht hatte Gitta verschlafen oder ist krank, vermutete ich. Dumm war nur, dass ich diesmal mit den Mathehausarbeiten nicht fertig war. Ich hatte gehofft, dass sie mir noch vor Unterrichtsbeginn die Antworten für die letzten zehn Aufgaben geben würde.
Wie immer ging Herrlich am Anfang der Stunde die Anwesenheitsliste durch: “Janno?” “Hier!” “Heidi?” “Hier!” “Peter?” “Hier!” “Karsten?” “Hier!” “Horst?” “Hier!” “Gerd?” “Hier!” “Brigitte?” Keine Antwort. “Brigitte?”, rief Herrlich noch einmal. Als wieder keine Antwort kam, fragte sie mich: “Karsten, weißt Du, wo Brigitte ist?” “Nö, keine Ahnung”, antwortete ich, worauf Herrlich erwiderte: “Karsten, es heißt nicht ‘Nö’, sondern ‘Nein’. Sprechen Sie wenigstens im Unterricht ein anständiges Deutsch. Weiß sonst jemand, warum sie nicht hier ist?” “Ich glaube, sie hat eine Erkältung”, wagte Monika eine Erklärung. “Vielleicht hat sie sich auf der Demonstration erkältet.” Herrlich schaute sie missbilligend an, las noch die anderen Namen vor; dann ging es mit diesen linearen Gleichungen los, unser neues Thema. Glücklicherweise rief sie mich nicht auf, und so konnte ich mich auf die Straßenbahnen konzentrieren, wobei ich bemerkte, dass sie so genau, wie es auf dem Fahrplan stand, nun auch wieder nicht waren. Nur die letzte, die manchmal zu spät kam, war heute auf die Sekunde pünktlich. Als es dann endlich zur Pause klingelte, lief ich, ohne meine Hausarbeiten abzugeben, schnell am Lehrertisch vorbei auf die Toilette, und hoffte, dass Herrlich frühestens am Abend merken würde, dass mein Heft fehlte.
Auch am Mittwoch war Gitta nicht da. Und am Donnerstag sagte Herr Kühn, dass die Eltern von Brigitte umgezogen seien und dass unsere Mitschülerin deshalb in eine andere Schule kommen würde. Wieso das, fast am Ende der 8., dachte ich noch und merkte, wie sich etwas in meiner Brust zusammenzog. Hätte sie mir nicht etwas sagen können? Und was ist mit Windjammer und Eis bei Kranzler? Nach dem Unterricht kam Monika an meiner Bank vorbei und flüsterte mir zu, dass sie gehört hätte, die Eltern seien nach “drüben” gegangen. Außerdem hätte Gitta ihr noch gestern gesagt, sie solle mir einen Gruß bestellen. “Verstanden habe ich das gestern ja nicht”, vertraute sie mir an. “Könnte sie den, also dich, nicht selber grüßen”, habe ich gedacht. Aber jetzt isses mir natürlich klar.”
Sie nicht mehr in meiner Schule und neben mir auf der Bank zu haben, war eigentlich nicht vorstellbar. Ich war wie erstarrt. Aber dann tröstete ich mich und dachte, ich besuche sie einfach, und vielleicht klappt es mit Windjammer und Eis ja doch noch.
“Weißt du, wo sie jetzt wohnt”, fragte ich Monika.
“Nee, aber wahrscheinlich im Flüchtlingslager. Weiß nicht, wo das ist.”
Ich hatte mal eins in der Wochenschau im Ringbahnkino an der S-Bahnhaltestelle Frankfurter Allee gesehen. Da wurde über die menschenunwürdigen Lebensumstände in den Lagern berichtet. Verhärmte Leute mit Rucksäcken und weinenden Kindern an der Hand, und alle hinter einem Drahtzaun. Da sollte jetzt auch Gitta sein? Ich schwor mir, sie zu finden, sobald sie aus dem Lager raus war und mit ihren Eltern eine eigene Wohnung hatte. Der Gedanke beruhigte mich etwas.
Vier Wochen später bekamen wir in der Aula unsere Zeugnisse. Der Chor, an diesem besonderen Tag im Weiß und Blau der Jungen Pioniere, sang “Im Frühtau zu Berge” und “Unsere Heimat”. Heidi sagte ein Schillergedicht auf, irgend etwas über einen Taucher. Gerlach las ein paar feierliche Sätze über unsere Verantwortung für die Zukunft von einem Zettel ab. Und dann lag die Grundschulzeit hinter uns.
Die Schüler der 8c gingen unterschiedliche Wege; Kalle wurde Malerlehrling, Gerd, Atze und Monika kamen auf eine Mittelschule und Heidi, Katrin und ich wurden auf den naturwissenschaftlichen Zweig einer Erweiterten Polytechnischen Oberschule delegiert. Wie das schon klang, “Polytechnische Oberschule”, und dann wurden wir sogar noch delegiert. Vati freute sich sehr über den Erfolg seines Sohnes. Ingenieur für Flugzeugbau sollte ich seiner Meinung nach werden, weil im Flugzeugbau die Zukunft läge. Ich war nicht so sicher, ob das Spaß machen würde. Außerdem hatte ich Angst vor Höhen. Selbst vom Müggelturm auf den See zu schauen, ließ mich schwindlig werden. Aber für Vati war nun mal Ingenieur für Flugzeugbau das Größte, was man so erreichen konnte. Und wegen meiner mäßigen Mathekenntnisse, sagte Vati, sollte ich mir mal keine Sorgen machen. Ein richtiger Seemanns- und Arbeitersohn schaffe das. Na gut, dachte ich, vielleicht hat er recht. Und auf eine Oberschule wollte ich auch gern gehen. Auf jeden Fall waren die nächsten vier Jahre erst einmal gesichert. Schmunzelnd sagte Mutti zu Vati: “ Das musst du gleich deiner Schwester und Mutter in Britz erzählen. Der Enkel und Neffe auf der Oberschule, das ist doch ein Erfolg für die ganze Familie. Da können sie stolz sein und wir natürlich auch.”
Doch ganz hatten wir die 8. noch nicht hinter uns. Herr Kühn schlug am Ende des Schuljahres vor, dass wir noch eine Abschlussfahrt machen sollten. Er kenne da noch eine schöne Jugendherberge in Waren, direkt an der Müritz. Da könnte man wandern, mit dem Boot fahren und auch schwimmen. Außerdem wäre es nicht so weit von Berlin entfernt. Wir wunderten uns über den Vorschlag. Es wäre sicher einfacher für ihn gewesen, alleine irgendwo hin zu fahren. Aber wir waren begeistert. Nach Jugendweihe und Schulabschluss erschien uns diese Fahrt als eine letzte Möglichkeit, sich der uns “anvertrauten” Verantwortung für ein paar Tage wieder zu entziehen. Was war dieses Erwachsenensein schon gegen ein paar Tage mit Freunden in einer Jugendherberge, die Hälfte davon Mädchen? Oder Kahn fahren auf der Müritz, in den umliegenden Kiefernwäldern herum schweifen, zusammen in der Küche Frühstück machen und heimlich irgendwo Bier besorgen. Endlich mal etwas nicht unter der Aufsicht der Eltern unternehmen. Kühn würde schon ein Auge zudrücken. Und doch mischte sich etwas Anderes, schwer Definierbares in die aufgekratzte Stimmung, die sich schon im D-Zugabteil beim Absingen der alten Ferienlagerlieder einstellte.
Da einige von uns schon im Juli zu Pionier-, FDJ- oder Betriebsferienlagern angemeldet waren, kam nur noch August in Frage. Der 12. August passte mehr oder weniger allen, und so zuckelte die 8c am Sonnabend mit dem D-Zug — Dampflokomotive, Holzbänke, — nach Waren, lag mit Pest vor Madagaskar, fühlte das regelmäßige Klank, Klank, wenn die stählernen Räder der grünen Waggons, die übrigens noch die abgerundete Form einer Postkutsche hatten, über die Lücken zwischen den Schienen hüpften, hörten das gedehnte, sehnsüchtige Pfeifen der Dampflok, hatten Hunger, Hunger, Hunger und verlangten in bester Stimmung nach dem uns trotz unseres Erwachsenenseins noch verbotenem Bier. Kühn saß abseits von uns weiter vorne im Gang. Als ich hinschaute, lächelte er nur und wandte sich wieder seinem Buch zu, bis wir in Waren ausstiegen.
Mann, war das ein trauriger Anblick. Das halbe Dach des Bahnhofsgebäudes fehlte, in einigen Ecken roch es nach Urin und die eigentlich roten Klinkersteine des kleinen Bahnhofs sahen verdreckt aus. Nur die ein, zwei Banner mit ihrer leuchtend roten Farbe, auf denen in Schwarz irgendetwas zur Landwirtschaft stand — Unter der Führung der Partei Anpassung der Lebensbedingungen von Stadt und Land . Bauern, für eine bessere Zukunft, kommt in die LPG — gaben dem Bahnhof etwas Helles. Nicht, dass uns die Banner besonders interessierten. Wir wollten zur Jugendherberge.
Wie der Bahnhof, war auch die Jugendherberge erst einmal enttäuschend. Die Fassaden des Fachwerkbaus waren angegraut, und an einigen Stellen fehlte sogar der Putz. Aber “unsere” Herberge lag dicht am Wasser und hatte neben der Badestelle auch einen Steg, an dem eine Reihe von alten Ruderkähnen angebunden war. Von einigen blätterte schon die grüne Farbe ab, aber Wasser schwappte nicht drin. Also sinken würden sie nicht. Das war schon mal gut, dachten wir. Dann führte uns der Jugendherbergsleiter, ein schlanker etwa 35jähriger, für uns uralter, Mann mit welligem, blondem Haar, kurzen schwarzen Hosen und dem Blauhemd der FDJ durch das große Gebäude, zeigte uns Küche und Waschräume und erklärte uns eine Reihe von Regeln, die zumindest ich mir nicht alle merken konnte. Wichtig schien ihm das Fegen des Fußbodens, die Geschirrwäsche — “Am besten, ihr wählt sofort einen Küchendienst”, empfahl er uns eindringlich — und das Einhalten der Nachtruhe zu sein. “Um zehn Uhr ist Nachtruhe”, sagte er mit leicht drohender Stimme, und dass danach kein Junge mehr etwas im Schlafraum der Mädchen zu suchen hätte. “Das muss ein Irrtum sein”, flüsterte mir Gerd grinsend ins Ohr. “Die Mädchen und Jungenschlafräume liegen doch sowieso dicht nebeneinander, da gehen wir doch nicht zur Nachtruhe raus, sondern rein.”
Platz in den zwei Schlafräumen war für zwanzig, aber bequem war es in unserem leider nicht. Auf dem Boden lagen mit Stroh gefüllte Säcke, die angenehm nach Heu rochen, aber selbst durch den blau karierten Bettbezug noch ganz schön piekten, und dann keine Kissen, dafür nur zwei alte Decken; “Pferdedecken” nannte sie Janno verächtlich, weil sie so aussahen, als hätten sie schon bessere, oder richtiger, schlechtere Tage hinter sich. Außerdem fehlten genügend Schränke für unsere Sachen. Die vorhandenen waren schon von anderen Herbergsgästen mit Beschlag belegt worden, was aber außer Jürgen, unserem Sauberkeits- und Ordnungsfanatiker, eigentlich niemanden sonst besonders störte.
Die Waschräume waren gleich nebenan, daneben lag das Zimmer der Mädchen; das hatte auch Atze gleich herausbekommen. Dann zeigte der Herbergsleiter uns noch die Küche mit Geschirr und Herd und ermahnte uns, unser Geschirr gleich nach dem Essen abzuwaschen. Kein Problem. Herr Kühn teilte sofort den Küchendienst ein. Jeweils vier von uns waren für Abendbrot, Frühstück und Abwasch verantwortlich. Morgen würden wir auf unserer Wanderung — verdammt, doch eine Wanderung, dachte ich — unterwegs essen, sagte er. Das hieß, der Küchendienst am Morgen war auch für die belegten Brote zuständig. Ich gehörte zur Frühstücksschicht.
Viel schliefen die meisten von uns Jungs nicht. Einige versuchten, durch den Waschraum ins Mädchenzimmer zu kommen. Doch ging das schlecht, weil die Mädchen ihre Tür abgeschlossen hatten. Atze und Janno klopften trotzdem an die Tür und baten: “Macht doch mal auf”, aber weit kamen sie damit nicht, weil die Mädchen einfach lachten und sich Herr Kühn, der mit den Jungs im gleichen Raum schlief, Ruhe ausbat, schließlich sei er sehr müde. Anfangs spielten einige Jungs noch Flak. Aus einem Bett schallte es aus dem Dunkeln: “Feindlicher Fliegerverband im Anflug Hannover/Braunschweig.” Und dann rief Gerd: “Fliegerverband in Planquadrat 3.” Da wusste Atze, der schon fast eingeschlafen war, sofort , dass über seinem Strohsack eine oder ein paar Mücken ihre Runden zogen. Natürlich versuchte er dann, sie mit lautem Klatschen seiner Hände “abzuschießen”. Langsam wurde es dann jedoch stiller, bis wir schließlich alle schliefen.
Aus der Wanderung wurde, fast hätte ich gesagt, glücklicherweise, nichts. Wir wurden nämlich ziemlich früh von ein paar Herbergsbewohnern aus Thüringen oder Sachsen geweckt. Man hörte an ihrem Dialekt, dass sie irgendwo aus dem Süden kamen. “Wacht auf, habt ihr schon gehört, die bauen eine Mauer durch Berlin, da kommt keinen mehr raus”, rief uns einer zu. Zuerst dachte ich, die Thüringer oder Sachsen wollten uns verarschen, weil sie neidisch waren, dass sie nicht so einfach wie wir nach drüben zum KDW oder ins Kino kamen. Außerdem, wie konnte man eine ganze Stadt durchtrennen. Unmöglich. Da gab es so viele Verbindungen: Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Straßen, Brücken, Seen und außerdem ‘ne Menge Schleichwege durch alte Luftschutzkeller in Wohnhäusern und Ruinen. Das schaffen die nie, dachte ich. Alles Quatsch. Doch als dann Kalle sein Sternchen anstellte und wir die Nachrichtensprecher hörten, wurde uns klar, dass sie recht hatten.
Im Gesellschaftsraum der Jugendherberge lief im Ostfernsehen gerade die Sendung “Weil ich jung bin”, ein musikalischer Bilderbogen mit Bärbel Wachholz. Wir aber hockten angespannt im Schlafraum um Kalles Kofferradio herum, wo es Nachrichten gab, damit wir ja alles mitkriegten, was da so lief. Auf dem einen Sender wurde gemeldet, dass die Regierung der Arbeiter und Bauern, um einen neuen Weltkrieg zu vermeiden, seit heute früh drei Uhr mit Unterstützung der sozialistischen Bruderländer einen antifaschistischen, demokratischen Schutzwall um die Frontstadt Westberlin errichte, damit wir von den Imperialisten und Junkern und ewig Gestrigen nicht mehr ausgeplündert werden könnten; und von einem anderen hörten wir, dass das Ulbrichtsche Unrechtsregime seine Bürger einsperren würde und sich der Eiserne Vorhang, entgegen dem Abkommen der Alliierten, unrechtmäßig auch über Berlin senken würde. “Scheiße”, dachte ich, “Scheiße”, sagte Janno. “Scheiße”, sagte Kalle, und “Scheiße”, sagte auch der sonst immer so ruhige Herr Kühn und fügte hinzu: “Die sagen immer, dass die Amis Schuld sind. Dieser sogenannte antifaschistische, demokratische Schutzwall, das waren die Russen. “Tut uns wirklich leid”, sagten die Thüringer oder Sachsen mit besorgten Gesichtern und meinten es ganz ehrlich.
Dieses Mitleid tat irgendwie gut, auch weil wir auf einmal zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Herbergsbewohner geworden waren, was uns Berliner irgendwie stolz machte. Trotzdem war ich mehr wütend als stolz, und in die Wut mischte sich Traurigkeit. In meinem Kopf herrschte auf einmal ein einziger Gedankenwirrwarr. Was wird mit den Britzern und Neuköllnern, was wird mit Oma und Tante Hete, Anna und Onkel Otto? Was mache ich jetzt noch mit dem Westgeld in der schönen braunen Brieftasche? Und Gitta, der Film im Europa Center, der Kuss? Monika hatte mir noch vor der Klassenfahrt gesagt, dass Gittas Eltern aus dem Lager raus wären und eine kleine Wohnung in der Westberliner Fennstraße bekommen hätten. Ich hätte sie also besuchen können.
Aus irgendeinem Grund bekam auf einmal Kalles Sternchen keinen Westberliner Sender mehr rein. Stattdessen nur noch Berliner Rundfunk und Deutschlandsender, die Interviews mit Arbeitern und anderen, offenbar bekannten Leuten brachten, die sich freuten, dass die Bonner Ultras und die Junker, mit den amerikanischen Imperialisten im Hintergrund, unserer DDR nichts mehr anhaben konnten, weil wir ja nun einen Schutzwall bauten. Dazwischen liefen ständig die uns vertrauten Kampflieder wie z. B. “Spaniens Himmel”, “Die Internationale”, “Mit Walter Ulbricht kämpft es sich gut” oder “Ich trage eine Fahne”. War es schon an diesem Sonntag, dass wir das Lied von Kahlau und Werzlau hörten?
[…]
Geht mit den Gewehren
Und haltet gute Wacht.
Wenn wir nicht kräftig wären,
Dann kämen sie mit Heeren.
Gebt auf die Grenzen acht.
[…]
Auf jeden Fall musste Herr Kühn nach der Sternchenmusik ganz plötzlich auf die Toilette. Nach dem Spülen hörten wir ihn auf einmal eine Strophe aus der “Forelle” singen:
[…]
Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht
Das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht,
So zuckte seine Rute, das Fischlein zappelt dran,
Und ich mit regem Blute sah die Betrogene an.
[…]
Still kam Herr Kühn ins Schlafzimmer zurück, schaute uns, die wir noch immer um das Sternchen herumsaßen, an und sagte dann sehr ruhig: “Ich geh mal kurz zum Bahnhof und kucke mir den Fahrplan an. Wir müssen nach Berlin zurück. Eure Eltern werden sich Sorgen machen.”
Als ich Montag zu Hause ankam, war Vati weg. Mutti umarmte mich und sagte mir unter Tränen, dass er als Mitglied der Kampfgruppe seines Betriebes in der Nähe des Brandenburger Tores stationiert worden sei. Sie wüsste zwar den Namen der Straße, aber nicht die Hausnummer. Auf jeden Fall wären er und seine Gruppe in Alarmbereitschaft und dürften nicht nach Hause. “Sonntag früh ist er mit einem Lastwagen abgeholt worden. Er hatte nicht mal Zeit, sich sein Rasierzeug einzupacken, und ich konnte ihm nicht mal ‘ne Stulle machen. Wer weiß, wann es bei solcher Aufregung mal was zu essen gibt. Hoffentlich kommt kein Krieg”, rief sie noch verzweifelt. “Wir haben ja gerade erst einen hinter uns gebracht. So etwas Schreckliches jetzt nicht noch einmal. Das darf einfach nicht sein.” Ihr Ausruf erinnerte mich sofort an die großen Anschauungsbilder an der Wand des Esszimmers in meinem Kindergarten in der Möllendorffstraße, in den mich Mutti als Kleinkind gesteckt hatte. Auf einem war eine Atomexplosion zu sehen war. Darunter stand dann — das lasen uns die Helferinnen vor — dass wir uns mit den Füßen dem Atompilz zugewandt, die Arme und Hände über dem Kopf, auf den Boden legen sollten, wenn die Amis ihre Atombomben abwerfen würden. Na das kann ja heiter werden, dachte ich.
Am Abend beschloss Mutti, morgen Vati mit mir zu besuchen. Sie wollte ihm wenigstens ein paar Butterstullen bringen. Außerdem hatte sie noch zwei Koteletts von Sonnabend und ein bisschen Sülze. Vati mochte Sülze besonders gern. Auch ein Paar dicke Socken, die er in den Stiefeln tragen konnte und noch etwas Unterwäsche könnte er sicher gut gebrauchen, fand sie. Dienstag früh fuhren dann wir mit der noch funktionierenden U-Bahn, bis zur Friedrichstraße und liefen dann in Richtung Scharnhorststraße. Mutti kannte die Gegend ziemlich gut, weil sie nahe der Invalidenstraße, also gar nicht weit weg, aufgewachsen war. An einem der alten Mietshäuser wurden wir von einem Mann in Stiefeln, grauem Kampfanzug mit der roten Fahne am linken Ärmel, grauem Tornister und lässig umgehangener russischer MPi angehalten. “Halt, wo wollen Sie hin?”, fragte er in scharfem Ton. Muttis Hand verkrampfte sich in meiner. “Ich will zu meinem Mann. Der ist bei der Kampfgruppe”, rief sie schluchzend. “Zeigen Sie mal Ihren Personalausweis!”, antwortete der Mann. Mutti kramte ihren Ausweis aus der Handtasche. “Wie heißt denn ihr Mann?”, fragte er etwas milder. “Gustl, Na Gustl.” “Gustl was?” “August Wegner. Ich will ihm doch nur ein paar Sachen bringen”, fügte sie hinzu. “Na ausnahmsweise”, antwortete er schon etwas milder. “Gehen Sie mal durch diesen Torbogen und dann rechts. Da fragen sie dann noch mal.”
Auch am Eingang zum ersten Hinterhof stand eine Wache, ein älterer Mann mit gleicher Ausrüstung wie der weiter vorne. Als ihm Mutti sagte, was sie wollte, schickte er sie noch einen Hinterhof weiter in den Eingang Seitenflügel rechts. Da gingen wir dann hin. Und als wir durch die Tür kamen, sahen wir schon eine Menge von grau Uniformierten rumstehen oder -sitzen. Mutti fragte laut nach Gustl Wegner “Ja, gehen Sie mal durch die Tür da hinten, die führt in den Keller. Da liegt die Bereitschaft.” Auf dem Weg nach unten war es ziemlich dunkel, weil nur zwei Glühbirnen brannten. Die anderen waren wohl kaputt. An der Wand war ein weiß leuchtender Pfeil mit einer Abkürzung, “Zum LSK” zu sehen. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, wollte aber Mutti nicht fragen, weil sie gerade Vati in einem Kellerverschlag entdeckt hatte, wo er in voller Ausrüstung auf einem Strohsack lag. “Gustl, Gustl”, rief sie laut und lief auf ihn zu. Vati sprang von seinem Bett auf, und dann lagen sich die beiden in den Armen. Als Vati mich sah, hob er mich hoch, was mir etwas peinlich war, denn ich war ja nun ganz offiziell seit über drei Monaten wirklich kein Kind mehr, und drückte mich heftig. Mutti erzählte ihm, was sie ihm alles mitgebracht hatte, und Vati freute sich. Obwohl, ich hatte den Eindruck, dass er sich mehr über uns als über die Sülze, die dicken Socken und den anderen Esskram gefreut hat. Mutti fragte ihn dann, ob sie nicht zusammen rausgehen sollten, weil man ja hier nicht richtig mit einander sprechen könnte. Doch Vati meinte, dass das nicht ginge, weil sich niemand von der Truppe entfernen dürfe.
Da entdeckte ich seine MPi auf dem Strohsack. Ich hob sie auf und wollte mir das Ding mal etwas genauer ansehen, drehte es hin und her und fragte Vati, wie viele Kugeln denn in so ein Magazin reingehen. “Fünfzig”, antwortete er und nahm mir die MP wieder aus der Hand. “Das ist kein Spielzeug”, sagte er mit sehr ernster Stimme. Als Mutti die MPi in Vatis Hand sah, fing sie an zu weinen. “Muss das wirklich sein?” “Ja, es muss wohl”, antwortete er resigniert. “Der Klassenfeind will uns unsere Errungenschaften wegnehmen.” “Und Deine Mutter und Deine Schwester in Britz?” Vati zuckte nur mit den Schultern. “Es wird schon nicht so schlimm werden. Wir können ja überhaupt nicht schießen, wir haben ja noch nicht einmal Munition bekommen, und in zwei drei Monaten wird sich alles wieder einrenken.”
Auf einmal tönte ein greller Pfiff durch den Keller. “Viertes Bataillon auf dem Hof antreten, Munitionsempfang”, kam von irgendwo im Keller der Befehl. Vati machte ein erschrockenes Gesicht, gab Mutti einen langen Kuss, legte seinen Arm um meine Schulter und sagte, während sein Nachbar ihm die MPi reichte, leise zu mir: “Pass gut auf Mutti auf, mein Sohn!”